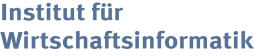Unsere Wissenschaftlerinnen
Die Universität Münster sowie unser Institut treten für die Geschlechtergerechtigkeit ein und streben eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Hier teilen unsere Wissenschaftlerinnen am Institut ihre Erfahrungen über eine wissenschaftliche Karriere in der Wirtschaftsinformatik. Damit möchten wir Studentinnen ermutigen, eine akademische Laufbahn einzuschlagen.
-
Melanie Schmidt
 Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in der Wirtschaftsinformatik tätig werden wollen?
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in der Wirtschaftsinformatik tätig werden wollen?
Ich habe direkt nach dem Abi gemerkt, dass Wirtschaftsinformatik etwas für mich ist. Ich habe mich direkt in den Bachelor eingeschrieben und hatte damals noch gar keine Ahnung, wie tief ich tatsächlich eintauchen würde und je mehr ich gelernt habe im Bachelor, Master und auch jetzt noch, desto mehr habe ich gemerkt, dass es voll mein Ding ist.
Warum Wirtschaftsinformatik und nicht reine Wirtschaft oder reine Informatik?
Am Anfang war ich selbst auf den informatischen Teil fokussiert, habe dann aber direkt gemerkt, dass das eigentlich gar kein Entweder-Oder ist, sondern dass die Wirtschaftsinformatik ein komplett eigenes, faszinierendes Feld ist und genau das Feld ist, das ich spannend finde.
Was war Ihr größter Erfolg in Ihrem akademischen Werdegang?
Mein größter Erfolg ist definitiv das ganze positive Feedback meiner Studierenden. Nach Lehrveranstaltungen oder nach Abschlussarbeiten haben sich recht viele die Zeit genommen, um mir nochmal zu sagen, dass sie meine Art mögen oder dass sie etwas mitgenommen haben. Das bedeutet mir einfach unglaublich viel, weil es mir zeigt, dass ich hier für diese Person einen kleinen Unterschied machen kann.
Möchten Sie auch nach Ihrer Promotion an der Universität bleiben?
Ich finde es erstmal grundsätzlich super cool, dass mir so viele Türen offenstehen: in Richtung Praxis oder Wissenschaft. Ob ich dann in der Wissenschaft bleibe, das lasse ich mir im Moment noch offen. Aber ich genieße es aktuell auch sehr, Teil der Community zu sein.
Was hätten Sie gerne über das Institut gewusst, bevor Sie nach Münster gekommen sind?
Ich hätte gerne früher gewusst, wie viele vielseitigen Angebote es vom Institut gibt. Es gibt total viele beeindruckende Möglichkeiten, sein Studium hier selber zu gestalten und wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht auch schon früher nach Münster gekommen.
-
Nina Herrmann
 Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in der Wirtschaftsinformatik tätig werden wollen?
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in der Wirtschaftsinformatik tätig werden wollen?
Ich habe erst während des Studiums gemerkt, dass ich da richtig viel Spaß dran hab. Vor dem Studium konnte ich ganz gut was mit Wirtschaft anfangen und mochte auch sehr gerne Informatik. Aber während des Studiums und gerade in den Phasen, in denen man anfängt, das Wissen anzuwenden, habe ich gemerkt, dass ich mich hier richtig wohlfühle.
Was hätten Sie gerne über das Institut gewusst, bevor Sie nach Münster gekommen sind?
Ich habe auch meinen Bachelor hier in Münster gemacht und was ich wirklich gerne im ersten Semester gewusst hätte, ist, dass es ein sehr großes Klausurenarchiv gibt, mit dem man sich auch wirklich gut vorbereiten kann.
Was war Ihr größter Erfolg in der Wissenschaft?
Ich habe im Juni 2024 meine Doktorarbeit abgegeben und die umfasst alles, was ich die letzten viereinhalb Jahre gemacht habe. Deswegen ist das definitiv meine größte Errungenschaft.
Warum möchten Sie weiterhin an der Universität bleiben?
Mir hat sowohl die Forschung als auch die Lehre sehr viel Spaß gebracht und da ich die Möglichkeit habe hier zu bleiben, wollte ich mal gucken, wo mich mein Weg weiter hinführt.
Welchen Rat möchten Sie den Studierenden für ihre weitere Zeit am Institut mitgeben?
Ich würde euch raten, immer Themen zu suchen, die euch begeistern und bei denen ihr auch einen Zweck drin seht, weil umso einfacher ist es, sich damit zu beschäftigen.
-
Miriam Möllers
 Was ist dein Forschungsgebiet?
Was ist dein Forschungsgebiet?
Ich bin seit März 2022 Doktorandin am Lehrstuhl für Digitale Transformation und Gesellschaft bei Jun. Prof. Benedikt Berger. Kurz gesagt beschäftige ich mich mit der Transformation der Arbeit durch die Nutzung von und Interaktion mit KI-basierten Systemen im Arbeitskontext. Insgesamt ist das ein sehr vielschichtiges und dynamisches Forschungsfeld, das vielfältige Themen abdeckt. Mich interessiert insbesondere wie die Nutzung KI-basierter Systeme bisherige Aufgaben und Arbeitsprozesse beeinflusst und damit einhergehend, wie die Arbeitnehmer*innen auf diese Veränderungen reagieren. Ein super spannendes Thema ist beispielsweise die berufliche Identität. Nah verwandt ist ebenfalls der Bereich der Mensch-Computer Interaktion, der u.a. untersucht, wie Individuen mit dem Output KI-basierter Systeme umgehen. Da das Thema in der Praxis gerade erst so richtig an Schwung gewinnt, gibt es noch viele offene Fragestellungen. Fürs Erste haben wir Anfang des Jahres mit einer Fallstudie begonnen, in der wir die Einführung von Machine Learning in der Finanzplanung begleiten.
Was ist das Ziel des Forschungsprojekts? Welche Ergebnisse werden erwartet?
Leider lassen sich Forschungsergebnisse nicht unbedingt vorhersagen, insbesondere dann, wenn der Mensch einen entscheidenden Faktor spielt. Da die Fallstudie qualitativer Natur ist, kann es gut sein, dass wir am Ende vor ganz anderen Erkenntnissen stehen als wir eigentlich erwartet hätten. Daher lässt sich hierzu noch nicht viel sagen. Was sich allerdings derzeit beobachten lässt ist folgendes: Der aktuelle gesellschaftliche Diskurs dreht sich um die Frage, welchen Einfluss KI-basierte Systeme auf die Arbeit haben - wird der Mensch in Zukunft arbeitslos oder passt er sich den veränderten Bedingungen an? Auch wenn wir zukünftige Entwicklungen nicht vorhersagen können, zeigen viele Studien derzeit, dass Mensch und System sich nicht unbedingt ersetzen, sondern vielmehr gegenseitig ergänzen können. Beide haben ihre jeweiligen Stärken und Limitationen, die sich gut komplementieren. Beispielsweise ist es wahrscheinlich, dass insbesondere die Analyse großer Datenmengen oder zeitintensive repetitive Aufgaben an Systeme übertragen werden, während der Mensch sich mit qualitativen Themen beschäftigt, die Güte des Outputs im Kontext bewertet und daraus sinnvolle Entscheidungen ableitet. Das ist auch im Bereich der Finanzplanung wahrscheinlich, da hier einerseits datengestützte Vorhersagen eine entscheidende Rolle spielen, aber auch ein tiefes, kausales Verständnis über das Geschäft und seine Einflüsse von großer Bedeutung sind.
Welches Fach und an welcher Universität hast du im Vorfeld studiert? Wie bist du zur Wirtschaftsinformatik und zu unserem Institut gekommen?
Ich sage immer, dass ich eine Reise durch die Wirtschaftswissenschaften gemacht habe. Angefangen habe ich mit Kulturwirtschaft im Bachelor an der Universität Duisburg-Essen. Das ist ein interdisziplinärer Studiengang der Wirtschaftswissenschaften und einer Sprachwissenschaft, in meinem Fall Anglistik. Das sind auf den ersten Blick erst einmal zwei sehr unterschiedliche Fächer, die aber in der Kulturwirtschaft zusammenkommen. In diesem Studiengang hatte ich im Grundlagenstudium bereits erste Berührungspunkte mit der Wirtschaftsinformatik, hätte aber zu dem Zeitpunkt nie gedacht, dass ich später einmal in diesem Bereich landen würde.
Da mich während meines Bachelorstudiums vor allem gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Themen ansprachen, habe ich mich für einen Master im Bereich der VWL entschieden. Neben einem recht ausgeprägten Fokus auf ökonometrische Methoden habe ich mich insbesondere mit Themen im Bereich der Finanzmarktanalyse beschäftigt. Erst zum Ende meines Masters bin ich auf den Bereich der Arbeitsmarktökonomie gestoßen, in dem ich dann auch meine Masterarbeit geschrieben habe.
Im Zuge der Masterarbeit habe ich mich auf Basis eines Paneldatensatzes mit der Frage beschäftigt, wie sich die Teilnahme an Weiterbildungen auf das Einkommen auswirken kann. Und in dem Forschungsfeld spielen auch die Themen rund um die Digitalisierung und dessen Einfluss auf die Arbeitsmärkte eine erhebliche Rolle. Schlussendlich sind die verändernden Anforderungen auf den Arbeitsmärkten durch die Digitalisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz mit die Hauptgründe für eine Weiterbildung. Und das fand ich spannend. Als ich mich entschied dem Thema der Promotion eine Chance zu geben, habe ich mir verschiedene Stellenangebote angeschaut, eigentlich im Bereich der Arbeitsmarkt- bzw. Bildungsökonomie. Durch Zufall habe ich dann die Stellenausschreibung von Benedikt Berger gesehen und allein der Schwerpunkt „Digitale Transformation und Gesellschaft“ weckte mein Interesse. Die Wirtschaftsinformatik hatte ich in dem Sinne gar nicht so auf dem Schirm. Bis auf den Umgang mit Statistiksoftware wie R und STATA hatte ich auch nur wenig Berührungspunkte mit dem Programmieren. Aber ich dachte mir, das könnte spannend sein und habe mich einfach beworben.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
Man befindet sich immer in einem Spannungsfeld zwischen der eigenen Forschung und den Verpflichtungen am Lehrstuhl und in der Lehre. Das ist sowohl das Reizvolle an der Arbeit als wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in als auch das Herausfordernde. Daran musste ich mich gerade im ersten Semester gewöhnen, zumal bei uns an der Juniorprofessur viele Prozesse noch nicht so etabliert waren und für mich das Forschungsfeld der WI ein ganz Neues war. Da wir eine Lehrveranstaltung übernommen hatten, steckten wir viel Zeit in die Überarbeitung der Inhalte. Das war einerseits eine gute Möglichkeit, mich mehr in die WI-Literatur einzuarbeiten, andererseits blieb nur wenig Zeit sich mit dem eigenen Forschungsthema zu beschäftigen. In diesem Spannungsfeld bewegt man sich eigentlich die ganze Zeit. Mittlerweile weiß ich aber, was meine konkreten Themen sind und kann meinen Arbeitsalltag gut strukturieren.
Idealerweise sieht der Arbeitsalltag so aus: Ich fange morgens immer mit meinen Mails an und versuche dann, mich am Vormittag mit meiner eigenen Forschung zu beschäftigen. Das ist die Zeit, in der ich am produktivsten und kreativsten bin und die Möglichkeit habe, etwas tiefer zu denken. Nachmittags widme ich mich dann eher der Lehre und den Terminen mit den Studierenden für die Abschlussarbeiten. Je nachdem, ob der Semesterbeginn naht oder eine Deadline kurz bevorsteht, kann der Tag aber auch ganz anders aussehen.
Was gefällt dir besonders an der Arbeit am Institut?
Mir gefällt die Vielfalt der Aufgaben. Einerseits gefällt mir die Arbeit in der Lehre, mit den Studierenden Seminarthemen zu besprechen oder die Übungen zu gestalten. Zum anderen beschäftige ich mich in meiner Forschung mit den Themen, die mich selbst besonders interessieren. Man hat auch sehr viele Freiheiten. Was auf der einen Seite toll ist, weil ich mir meinen Arbeitsalltag frei einteilen kann, aber manchmal auch dazu führt, dass die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit etwas verschwimmen und man erst lernen muss, damit zu jonglieren. Außerdem gefällt mir das internationale Umfeld – da wir uns den Flur mit dem Lehrstuhl von Prof. Klein teilen, sind oft Gastwissenschaftler*innen vor Ort, die immer ein offenes Ohr haben und gerne ihre (oft langjährigen) Erfahrungen teilen. Insgesamt ist das Umfeld sehr dynamisch und jung, was das Arbeiten sehr entspannt und abwechslungsreich macht.
Die Wirtschaftsinformatik erscheint oft als ein männlich dominiertes Arbeits- und Forschungsgebiet. Was hat dich als Frau motiviert, in der WI akademisch tätig zu werden?
Ich will dem gar nicht widersprechen, allerdings ist zumindest das akademische Umfeld meiner Wahrnehmung nach gar nicht so männerdominiert, wie man es von außen vermuten würde. Natürlich sind die Verhältnisse in der Studierendenschaft nicht ausgeglichen, aber gleichzeitig sehe ich mich als Frau bei den Mitarbeitenden am Institut nicht in der Minderheit. In meinem Forschungs- und Arbeitsfeld erscheint es mir nicht nach einer männerdominierten Branche – man muss aber auch dazu sagen, dass wir in unserem Forschungsbereich am Lehrstuhl die typische Schnittstelle der Wirtschaftsinformatik bedienen und somit näher an soziologischen Themen als an rein technischen Themen sind. In der freien Wirtschaft kann das auch wiederum anders aussehen als im universitären Bereich.
Was sind Vorurteile gegenüber der Arbeit im MINT-Bereich, die eigentlich nicht stimmen?
Im Bachelorstudium habe ich die Wirtschaftsinformatik als recht trockenes Fach kennengelernt. Wir mussten viele Definitionen und Prozesse auswendig lernen und lernten SQL-Codes ohne das System wirklich zu nutzen. Natürlich hat sich inzwischen mein Bild über die WI geändert und ich weiß insbesondere das interdisziplinäre Forschungsfeld zu schätzen. Ich wusste schlichtweg nicht, dass gerade soziale Fragestellungen ein wesentlicher Bestandteil der WI sind.
Hast du Tipps für zukünftige Bewerberinnen und Berufseinsteigerinnen?
In der Schule fielen mir sowohl Sprachen als auch Mathe leicht, was ich bei meiner Studienwahl versucht hatte zu berücksichtigen. Unter einem technischen Studium konnte ich mir aufgrund mangelnder Berührungspunkte nur wenig vorstellen, weshalb ich mich dann in die Richtung der Wirtschafts- und Sprachwissenschaften begab. Erst im Studium merkte ich, dass Programmieren wirklich Spaß machen kann und die Technik so viel zu bieten hat. Dementsprechend kann man den Schulabgänger*innen mit auf den Weg geben: Wenn ihr ein bisschen Interesse an Technik habt, am Programmieren, dann probiert das aus! Entweder merkt man, dass das genau das ist, was man schon immer machen wollte, oder man merkt auf dem Weg dorthin, dass es doch nicht so passt. Gerade die Wirtschaftsinformatik bietet genügend Raum mehr in die technische oder wirtschaftliche Richtung zu gehen. Das ist meiner Ansicht nach der entscheidende Aspekt, dass es bei vielen Frauen gar nicht am mangelnden Interesse liegt, sondern an mangelnden Berührungspunkten.
-
Dr. Katrin Bergener
 Seit wann arbeiten Sie am Institut und welche Aufgaben umfassen Ihren Tätigkeitsbereich?
Seit wann arbeiten Sie am Institut und welche Aufgaben umfassen Ihren Tätigkeitsbereich?
Ich arbeite schon sehr lange am Institut für Wirtschaftsinformatik. 2006 habe ich hier angefangen und für ein knappes Jahr während meines Studiums als studentische Hilfskraft gearbeitet. Anschließend war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Becker am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement tätig und habe 2014 meine Promotion abgeschlossen. Seitdem habe ich vielfältige Aufgaben übernommen. In der Lehre betreue ich beispielsweise mit Armin Stein und Bettina Distel seit Jahren unsere Vorlesung "Einführung in die Wirtschaftsinformatik" für die Erstsemester-Studierenden. Außerdem biete ich mit Kolleg*innen regelmäßig Vertiefungsmodule an, gerne auch mit internationalen Partner*innen, zum Beispiel mit der University of West Georgia. Ich betreue Bachelor- und Masterarbeiten, halte den Bachelorvorbereitungskurs, bin zuständig für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit und arbeite aktuell auch noch an einem Erasmus+ Forschungsprojekt gemeinsam mit Armin Stein und Kilian Müller sowie Kolleginnen aus Grenoble und Liechtenstein. Darüber hinaus bin ich auch Koordinatorin des WWU Centrum Europa, das ist ein universitätsweites Zentrum, wo sich Mitglieder aus allen Bereichen der Universität, die an europabezogenen Aktivitäten arbeiten, bündeln. Mir wird also nicht langweilig.
Wie hat sich Ihr akademischer und beruflicher Werdegang gestaltet?
Ich bin tatsächlich damals als Fachfremde ans Institut für Wirtschaftsinformatik gekommen. Studiert habe ich Allgemeine Sprachwissenschaft in Münster und in Auckland, Neuseeland. Während meines Studiums habe ich durch Zufall eine Stellenausschreibung am Institut für Wirtschaftsinformatik gesehen, in der studentische Hilfskräfte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Übersetzungstätigkeiten gesucht wurden. So habe ich dann als Studentin eines ganz anderen Studiengang und das Institut und auch die Vielfalt der Themen, an denen geforscht und gelehrt wird, kennengelernt. Das hat mein Interesse geweckt. Nach meinem Studium hat sich dann die Möglichkeit ergeben, im Forschungsprojekt ManKIP - Management kreativitätsintensiver Prozesse – als wissenschaftliche Hilfskraft mitzuarbeiten. Da habe ich die die Forschungsarbeit immer näher kennengelernt und es reifte über Monate die Idee, vielleicht in dem Kontext auch meine Doktorarbeit zu schreiben. Dafür musste ich aber in einem Zeitraum von zwei Jahren etliche WI-Kurse nachholen, um als Fachfremde in der Wirtschaftsinformatik als Doktorandin für das Promotionsstudium zugelassen zu werden. Das war eine Herausforderung und es war nicht immer einfach. Aber mir hat es Spaß gemacht, es hat gut funktioniert und im Nachhinein kann ich auf jeden Fall sagen, dass es die Sache wert war. Da hat sich für mich ein völlig neuer Bereich erschlossen und wie man sieht, bin ich dann der WI treu geblieben.
Wirtschaftsinformatik wirkt häufig wie ein männerdominiertes Arbeits- und Forschungsfeld. Was hat Sie dazu motiviert, als Frau in der WI akademisch tätig zu werden?
Durch meine Arbeit am ersten Forschungsprojekt ManKIP habe ich schon mitbekommen, wie vielfältig das Fach WI eigentlich ist. Die Wirtschaftsinformatik beschäftigt sich ja grundsätzlich mit der Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sowie der Entwicklung und Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen in diesen Bereichen. Die fortschreitende Digitalisierung, die man in den letzten Jahrzehnten beobachten konnte, hat natürlich Einfluss auf alle Lebensbereiche und Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrem Ausbildungshintergrund, ihrem aktuellen Lebensabschnitt etc. Und deswegen denke ich auch, dass das für alle inhärent gleich interessant sein müsste.
Im Rahmen meiner Promotion ging es viel um (virtuelle) kreative Teams und wie diese zusammenarbeiten können, da habe ich mich viel mit der Forschung zu Teamzusammensetzungen beschäftigt. Die Forschung zeigt, dass in diversen Teams (divers meint hier nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch nach Alter, Sprache und kulturellem Hintergrund), zwar häufig Herausforderungen entstehen, aber dass durch diese verschiedenen Hintergründe auch viel unterschiedliches Wissen mitgebracht wird. Diverse Teams sind häufig innovativer und generell erfolgreicher. Deswegen fände ich es unglaublich wichtig und schön, wenn wir in der WI auch möglichst divers aufgestellt wären. Ich persönlich finde es auch immer spannend mit Leuten mit verschiedenen Hintergründen und Sichtweisen zusammenzuarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass das sowohl für die Lehre als auch für die Forschung bei uns am Institut eigentlich nur förderlich sein kann.
Seit ich am Institut arbeite, hatte ich nie das Gefühl, nicht aufgenommen oder nicht akzeptiert zu sein. Es waren immer mehr Männer als Frauen am Institut, aber das war nie ein Problem, da kann ich echt nur eine Lanze für meine männlichen Kollegen brechen. Nichtsdestotrotz fände ich es schön, wenn wir generell noch diverser werden könnten am Institut für Wirtschaftsinformatik.
Was sind Vorurteile gegenüber der Arbeit im MINT-Bereich, die eigentlich nicht stimmen?
Kinder haben häufig schon kulturelle Vorurteile verinnerlicht, zum Beispiel dass Mädchen sich weniger für Informatik und Naturwissenschaften interessieren als Jungs. Und wenn dann bestimmte Aktivitäten und Schulfächer schon von klein auf so vorurteilsbehaftet sind, dann beeinflusst das natürlich auch das generelle Interesse daran. Wenn ich das als Kind schon immer so mitbekomme, dann komme ich vielleicht auch später nicht auf die Idee, Mathe oder Informatik zu studieren.
Deswegen fände ich es schön, wenn man Jungs und Mädchen möglichst vorurteilsfrei aufzeigen kann, welche Möglichkeiten es für sie im MINT-Bereich gibt. Im besten Fall passiert das spielerisch schon in der Kita und in der Grundschule, indem man völlig wertfrei viel ausprobiert und erlebbar macht.
Das haben wir uns auch bei unserem Projekt digital me vor ein paar Jahren gedacht und haben uns genau das vorgenommen: IT-Berufe erlebbar machen. Dafür haben wir die Website IT for Girls entwickelt, auf der sich Mädchen und junge Frauen spielerisch mit IT-Berufen beschäftigen können. Es gibt einen Avatar, Anna, die durch eine Stadt leitet, in der es verschiedene Häuser gibt, in denen man unterschiedliche IT-Berufe kennenlernt. Und zu jedem Beruf gibt es ein Spiel, in welchem man seine Fähigkeiten für diesen Beruf testen kann, es gibt Videos und Interviews mit Frauen, die in den Berufen arbeiten und erzählen, wie ihr Tag eigentlich strukturiert ist. Damit wollen wir die vielfältigen beruflichen Perspektiven aufzeigen und darüber hinaus veranschaulichen, dass man in IT-Berufen auch kreativ sein kann und häufig im Team arbeitet. Das Ziel war, dass die Mädchen erkunden und selbst erleben können, was es eigentlich heißt, in diesen Berufen zu arbeiten und unter Umständen bestehende Vorurteile abzubauen.
Was gefällt Ihnen besonders gut an der Tätigkeit in einer akademischen Einrichtung?
In erster Linie gefällt mir die Freiheit, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit habe: Mit dem breiten Spektrum meiner aktuellen Aufgaben kann ich interessensgetriebene Forschungsprojekte beantragen und durchführen. Ich kann Lehrveranstaltungen zu Themen anbieten, die mir Spaß machen und Abschlussarbeiten betreuen, die mich interessieren. Zudem arbeite ich auch sehr gerne in der Forschung und in der Lehre mit internationalen Teams, mit Kolleg*innen aus der ganzen Welt zusammen. Das ERCIS ist für mich über die Jahre wirklich wie eine Familie geworden und man freut sich immer, wenn man Kolleg*innen auf Konferenzen oder Veranstaltungen trifft. Diese engen Verbindung und diesen Austausch mit den internationalen Kolleg*innen finde ich unglaublich wertvoll.
Was für mich ganz persönlich auch nicht zu vernachlässigen ist: An der Universität habe ich mit meiner Tätigkeit sehr viel zeitliche Flexibilität und als Mutter mit zwei Schulkindern ist das schon einmal viel wert. Auch vor Corona hatte ich schon sehr Flexibilität in meiner Arbeit, aber die Pandemie hat uns allen nochmal gezeigt, dass viele unserer Tätigkeiten auch aus dem Home-Office gut funktionieren - diese zeitliche und räumliche Flexibilität ist für einen entspannten Familienalltag unglaublich hilfreich.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Einen ganz typischen Arbeitsalltag gibt es bei mir nicht wirklich und durch Corona sahen die Arbeitstage in den letzten zwei Jahren auch nochmal ganz anders aus als davor. Aber grundsätzlich:Ich trinke immer zuerst einen Kaffee und checke meine Emails. Dann schaue ich, häufig zusammen mit Armin Stein, was an dem Tag so ansteht, da wir viel in der Lehre und im ERCIS gemeinsam machen. Dann habe ich Termine mit Kolleg*innen intern und extern zur Absprache für Forschungsprojekte, zur Koordination im ERCIS, zu Vorbereitung von Lehre etc., Publikationen müssen gelesen oder an ihnen gearbeitet werden. Darüber hinaus bin ich seit 2016 Koordinatorin des WWU Centrum Europa und in dieser Funktion bin ich auch regelmäßig in Meetings, beantworte Fragen von Forscher*innen zur EU-Förderung, gebe Feedback zu Anträgen oder stelle Kontakte zu Ansprechpersonen in Brüssel her. Dann habe ich natürlich während des Semesters auch noch Lehrtermine dazwischen. Wenn ich Abschlussarbeiten betreue, habe ich dazu natürlich auch regelmäßige Termine mit den Studierenden, um Rücksprache zu halten. Was auch noch zur Arbeit im akademischen Umfeld gehört, ist die akademische Selbstverwaltung, also die aktive Mitarbeit in Gremien oder Kommissionen. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich dort einbringt und ich bin schon seit längerem ordentliches Mitglied in der Rektoratskommission Internationalisierung und auch in dem Rahmen gibt es natürlich regelmäßige Treffen oder Arbeitsgruppen. Es sind so vielfältige Aufgaben, jeder Tag sieht anders aus, je nachdem welchen Hut ich gerade auf habe - Europazentrum, ERCIS, Lehre, Forschung oder Öffentlichkeitsarbeit. Gerade das mag ich aber, das macht die Arbeit niemals langweilig.
Was war bisher Ihr spannendstes Projekt?
Ich habe schon an echt vielen interessanten Projekten über die Jahre hinweg gearbeitet, aber ich finde gerade mein aktuell laufendes Erasmus+-gefördertes Projekt AI-bility, das ich mit Armin Stein, Kilian Müller und mit den Kolleginnen aus Grenoble und Liechtenstein durchführe, super spannend. Das Projekt ist gerade erst angelaufen, aber wir wollen in den nächsten zwei Jahren untersuchen, wie Schulkinder im Alter von elf bis dreizehn Jahren mit künstlicher Intelligenz umgehen und dabei Konzepte wie beispielsweise Vertrauen und Intelligenz in Bezug auf Conversational Agents (Alexa, Google Home, Siri etc.) untersuchen. Wir beschäftigen uns also mit Fragen wie: Wie nehmen Kinder künstliche Intelligenz wahr? In welchen Kontexten und für welche Aktivitäten greifen sie auf Conversational Agents zurück? Stellen Kinder die Antworten von Conversational Agents in Frage etc.?
Dafür gehen wir zu unterschiedlichen Schulen und führen dort Fokusgruppeninterviews durch. Basierend auf den Ergebnissen der Interviews werden wir dann ein Experiment aufsetzen und dieses dann im kommenden Jahr an den Schulen durchführen. Damit wollen wir beobachten, ob es für die Kinder einen Unterschied macht, ob sie mit einer Alexa interagieren (kein Körper) oder mit dem Nao-Roboter (ausgefeilter Roboter). Gerade weil das Thema künstliche Intelligenz ein Thema ist, das immer mehr Einfluss in unserer Gesellschaft hat und vielleicht auch, weil ich selbst ein Kind in dem Alter habe, finde ich es spannend zu untersuchen und zu beobachten, wie Kinder mit Conversational Agents umgehen, wie sie diese wahrnehmen und ob man daraus irgendetwas ableiten kann.